Als ich das erste Mal vom Mercedes AMG GT Concept hörte, dachte ich ehrlich gesagt: „Schon wieder so eine Studie, die nie das Licht der Serienwelt erblicken wird.“ Aber nachdem ich mich intensiv mit der Technologie beschäftigt habe, muss ich zugeben – das hier ist anders. Mit meinen mehreren Jahren Erfahrung in der Elektromobilität habe ich schon viele vollmundige Versprechen gehört. Doch was Mercedes AMG GT Concept vorstellt, könnte tatsächlich die Ladeinfrastruktur revolutionieren. 400 Kilometer Reichweite in nur fünf Minuten? Das klingt zu schön, um wahr zu sein.
Quiz-Time! Machen Sie mit bei meinem Kurz-Quiz zum Thema dieses Artikels!
Hätten Sie es gewusst…?
Wann wurde der Mercedes AMG GT Concept erstmals vorgestellt?
Die revolutionäre Zellkonstruktion: Dünn, hoch und kühl
Mercedes geht beim AMG GT Concept einen völlig anderen Weg als BMW oder Tesla. Während diese auf dickere zylindrische Zellen setzen, um mehr Energie unterzubringen, wählt Mercedes bewusst schmale, hohe Rundzellen. Diese ungewöhnliche Form hat einen entscheidenden Vorteil: Die Wärme kann durch die kürzeren Wärmepfade schneller aus dem Zellinneren abgeführt werden. Die Zellen erreichen eine beeindruckende Energiedichte von über 300 Wh/kg beziehungsweise 740 Wh/l auf Zellebene. Das sind Werte, die selbst ich als langjähriger Elektroauto-Enthusiast so noch nicht gesehen habe. Die schlanke Bauweise ermöglicht eine effizientere Kühlung und damit bessere Schnellladefähigkeit – ein cleverer Ansatz.
Aluminium statt Stahl: Leichtbau für bessere Performance
Ein weiterer interessanter Aspekt ist die Materialwahl für die Zellhüllen. Während einige Hersteller wie BMW häufig Stahlhüllen nutzen, verwenden andere – darunter auch Tesla – je nach Zelltyp ebenfalls Aluminium; Mercedes setzt beim AMG GT Concept gezielt auf Aluminiumhüllen zur Optimierung von Gewicht und Thermik.
Diese Entscheidung zahlt sich bei hohen Belastungen aus, da der Wärmetransfer deutlich schneller funktioniert. Als jemand, der schon verschiedene Elektroautos gefahren ist – vom Renault Zoe bis zum BMW i3 – weiß ich, wie wichtig effizientes Thermomanagement ist.
Mein Tipp: THG-Prämie 2025 einlösen – viele E-Autofahrer vergessen es
Vielen Elektroautofahrern ist gar nicht bekannt, dass sie – Jahr für Jahr aufs neue – danke E-Auto ein Anrecht aufs Einlösen der sog. THG-Prämie haben. Diese Prämie belohnt E-Autofahrer für ihren Beitrag zum Umweltschutz.
Das Problem ist jedoch, dass die THG-Prämie dem Begünstigten nicht einfach zufällt: Sie muss vielmehr „eingelöst“ werden. Und das lohnt sich, erhält die im Fahrzeugschein registrierte Person (auch bei Leasing) eine nette, hohe zweistellige bis niedrige dreistellige Summe.
Zum Einlösen kann man auf diverse Anbieter zurückgreifen, die sich um die Bürokratie kümmern. Selbst einreichen kann man die THG-Quote nicht.
Einen guten Überblick über die verschiedenen Anbieter haben wir bei diesem THG Quoten Vergleichsportal gefunden.
Die beste Quote gibt es derzeit übrigens bei Geld für eAuto – über diesen Link erhalten Neukunden 135€ Prämie (statt wie üblich 110€).
Full-Tab-Technologie: Bewährte Technik clever genutzt
Mercedes setzt beim Full-Tab-Design auf mehrere Stromabnahmepunkte pro Elektrode – ein Ansatz, der dem tabless Design von Tesla ähnelt, aber technologisch nicht identisch ist. Der Vorteil liegt im geringeren Innenwiderstand und weniger Hitzestaus, was effizienteres Schnellladen ermöglicht. Diese Technik stammt ursprünglich aus der Superkondensator-Entwicklung und zeigt, wie bewährte Lösungen in neuen Anwendungen brillieren können.
Rückgriff auf modularen Aufbau: Gegen den Trend
Während viele Hersteller auf Cell-to-Pack setzen und Zellen direkt ins Gehäuse integrieren, geht Mercedes bewusst den klassischen Weg zurück. Die Zellen sind in lasergeschweißten Kunststoffmodulen zusammengefasst, die dann in das Batteriegehäuse integriert werden. Dieser Cell-to-Module-to-Pack-Ansatz ermöglicht die Integration eines komplexeren Kühlsystems – der Schlüssel für die extreme Ladeleistung.
Direkte Flüssigkühlung: Revolutionär oder übertrieben?
Hier wird es wirklich interessant: Mercedes plant laut eigenen Angaben eine direkte Flüssigkühlung jeder Zelle mit einem elektrisch nicht leitenden Öl – eine bisher nur im Hochleistungsbereich eingesetzte Technologie, deren Alltagstauglichkeit noch nicht nachgewiesen ist.
Das ist eine radikale Abkehr von der üblichen indirekten Kühlung über Kühlplatten. Die Zellen sind zur Kühlung von einem speziellen Öl umströmt, das für dauerhaft gute Performance sorgen soll. Diese Technologie kenne ich bisher nur aus Supersportwagen wie dem Koenigsegg oder McLaren. Für Massenmodelle wäre das deutlich zu teuer und komplex.

NCMA-Kathode und Silizium-Anode: Hightech-Chemie
Die Zellchemie basiert auf NCMA (Nickel, Kobalt, Mangan, Aluminium) in der Kathode sowie einer siliziumhaltigen Anode. Die Silizium-Anode ist besonders interessant, da sie mehr Lithium speichern und schneller laden kann als herkömmliches Graphit. Allerdings hat sie auch Nachteile: kürzere Lebensdauer und höhere Kosten. Das Material kommt vermutlich von Sila Nanotechnologies, einem US-Startup mit Mercedes-Investment. Die NCMA-Kathode bietet höhere thermische Stabilität und längere Lebensdauer, allerdings bei geringfügig niedrigerer Kapazität.
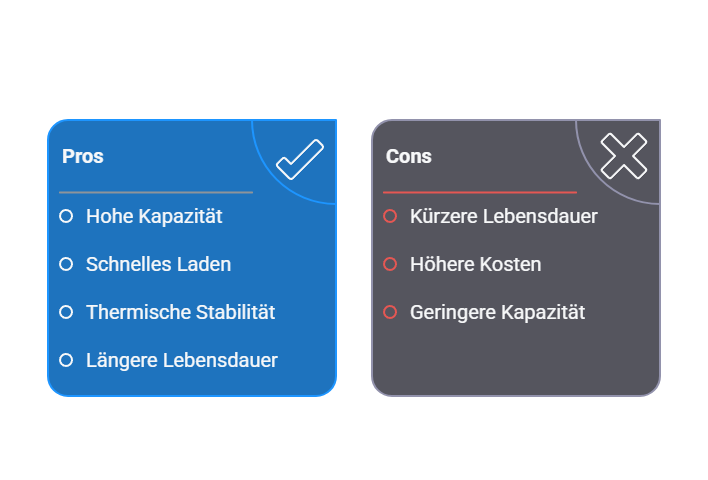
800-Volt-System: Basis für extreme Ladeleistung
Das Concept AMG GT XX arbeitet mit über 800 Volt Spannung und ermöglicht höhere Ladeleistung bei dünneren, leichteren Kabeln. Die Batteriekapazität liegt zwischen 80 und 100 kWh und besteht aus mehr als 3.000 Rundzellen. Diese hohe Spannung ist entscheidend für die anvisierten Ladeleistungen von über 850 kW.
Alpitronic-Ladesäule: 1000 Ampere über Standard-CCS
Das wirklich Bemerkenswerte: Mercedes testet mit Alpitronic eine Prototyp-Ladesäule, die 1.000 Ampere liefert – jedoch nicht über Standard-CCS-Kabel, sondern über spezielle, aktiv gekühlte Hochstromverbindungen außerhalb der aktuellen CCS-Spezifikation. Normalerweise liegt die Stromstärke bei DC-Ladern nur bei 500 Ampere, aber diese Prototyp-Ladesäule schafft das Doppelte. Das ist notwendig, um die volle Ladeleistung von über 850 kW nutzen zu können.
Axialfluss-Motoren: Die Zukunft des elektrischen Antriebs
Laut Mercedes erreicht das Concept AMG GT XX mit drei Axialflussmotoren von YASA eine kombinierte Spitzenleistung von über 1.000 kW. Bei Axialfluss-Motoren verläuft der magnetische Fluss parallel zur Drehachse, nicht radial wie bei herkömmlichen Motoren. Diese Bauweise ermöglicht eine kompakte, scheibenförmige Konstruktion mit höherer Leistungsdichte. Die Axialfluss-Motoren wiegen nur etwa ein Drittel so viel und sind um zwei Drittel schmaler als Radialfluss-Varianten. Axialfluss-Motoren erreichen eine etwa dreifach höhere Leistungsdichte als herkömmliche Elektromotoren und sind dabei kompakter und leichter.
Drei-Motor-Konfiguration: Intelligenter Allradantrieb
Zwei Axialfluss-Motoren sind an der Hinterachse in einer kompakten Einheit mit Planetengetriebe und Inverter integriert, ein weiterer Motor sitzt an der Vorderachse als Boost-Antrieb. Die gesamte Electric Drive Unit wiegt vorne nur 80 Kilogramm und hinten 140 kg. Diese Konfiguration ermöglicht nicht nur Allradantrieb auf Abruf, sondern minimiert Energieverluste im Normalbetrieb.
Achtung, Elektromobilisten! Sie möchten nicht nur spannende Inhalte lesen, sondern auch mit mir und anderen Elektroauto-Begeisterten diskutieren?
Dann schließen Sie sich, wie ich, dem Elektroauto-Forum.de an. Deutschlands größte Elektroauto Community!
Serienproduktion: Berlin statt Träume
Die innovativen Axialfluss-Motoren werden 2026 in die Serienproduktion gehen und im Mercedes-Benz Werk Berlin-Marienfelde gefertigt. Das zeigt, dass Mercedes es ernst meint mit dieser Technologie. Mercedes-Entwicklungsvorstand Markus Schäfer bestätigt: „Beim Concept AMG GT XX werden wir den Axialfluss-Motor-Antrieb und die Batterietechnologie in die Serie übertragen“.
Mercedes AMG GT Concept Performance: Mehr als nur Zahlenspiele
Mit der kombinierten Leistung von über 1.000 kW soll der AMG GT XX mehr als 360 km/h erreichen. Doch das Beeindruckende ist die Dauerleistung: Die Batterie bleibt auch bei forciertem Fahreinsatz in einem optimalen Temperaturbereich, der neben der Leistung auf der Straße auch besonders schnelles Laden ermöglicht. Nach dem Ladestopp kann das Fahrzeug sofort wieder die volle Leistung abrufen – eine bisher nie dagewesene Fähigkeit.
Ladeleistung: Die 5-Minuten-Revolution
Das Konzeptfahrzeug kann in rund fünf Minuten Energie für etwa 400 Kilometer WLTP-Reichweite nachladen, dank einer durchschnittlichen Ladeleistung von über 850 kW. Im SoC-Bereich bis 80 Prozent soll sich eine flache Ladekurve ergeben, die Ladeleistung soll über einen großen Bereich über 850 kW bei 1.000 Ampere betragen. Das wäre tatsächlich schneller als tanken!
Aerodynamik und Design: Funktion folgt Form
Der von Mercedes angegebene cW-Wert von 0,198 für das Concept-Fahrzeug liegt zwar unter dem des EQS, wurde aber bislang nicht unabhängig geprüft und bezieht sich auf einen idealisierten Konzeptstatus. Die 21-Zoll-Räder sind mit beweglichen „Aeroblades“ ausgestattet, die sich nur bei Bedarf öffnen, um die Bremsen zu kühlen. Diese Details zeigen, wie wichtig Effizienz für die angepeilten Reichweiten ist.
Realitätscheck: Brillante Technik, aber…
Die Technologie ist zweifellos beeindruckend, aber es bleiben kritische Fragen. Die Kosten für Silizium-Anoden, direkte Kühlung und komplexe Module dürften immens sein. Lebensdauer und Sicherheit unter diesen extremen Ladeleistungen sind noch nicht langzeiterprobt. Und bisher gibt es keine unabhängige Prüfung der Leistungsdaten.
Fazit: Revolution oder Nischentechnologie?
Mercedes zeigt mit dem AMG GT Concept, was technisch möglich ist, wenn Geld keine Rolle spielt. Die Technologie ist faszinierend, aber aktuell noch eher Spielwiese für Supersportwagen als Alltagslösung. Dennoch: Wenn diese Innovationen schrittweise in erschwinglichere Modelle einfließen, könnte das die Elektromobilität grundlegend verändern.
Die wichtigste Erkenntnis bleibt: Ladegeschwindigkeit ist nicht das Problem. Die Herausforderung liegt darin, das Ganze haltbar, sicher und bezahlbar zu machen. Aber als jemand, der die Entwicklung der Elektromobilität seit Jahren verfolgt, bin ich durchaus optimistisch, dass wir hier den Grundstein für die nächste Generation der Elektroautos sehen.
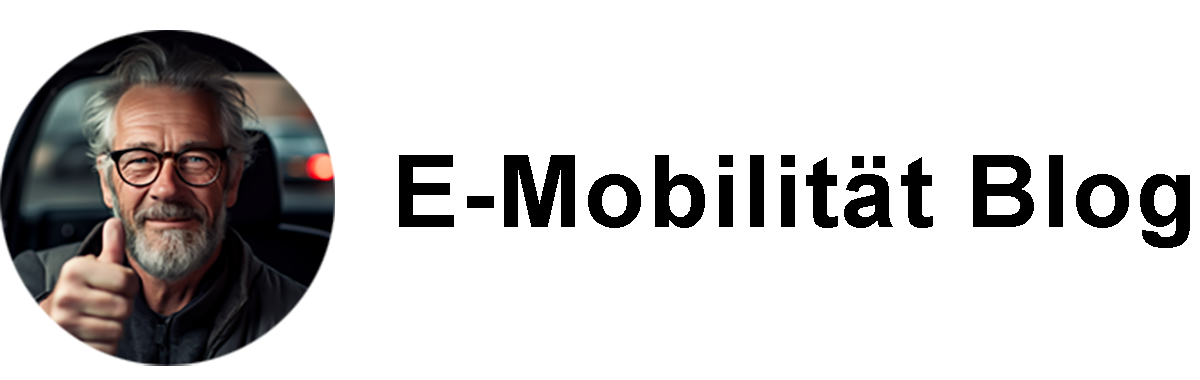

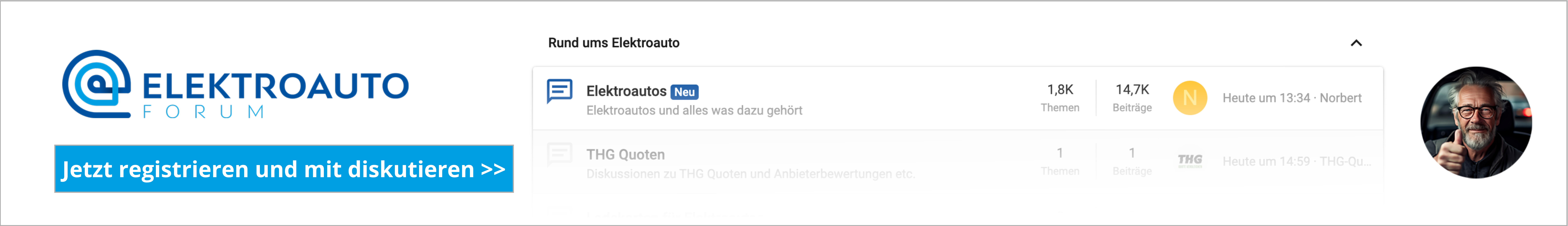

Hinweis für meine Blog-Besucher:
Ich habe eine Kooperation mit dem THG-Anbieter "Geld für eAuto" geschlossen. Über diesen Link erhalten Besucher 15€ mehr als THG-Quote (normal: 110€; über meinen Link: 125€) und ich erhalte eine Provision.
Außerdem möchte ich Ihnen "Ladekarten-Vergleichen.de" ans Herz legen - die Kollegen vergleichen tagesaktuell die besten Ladetarife: